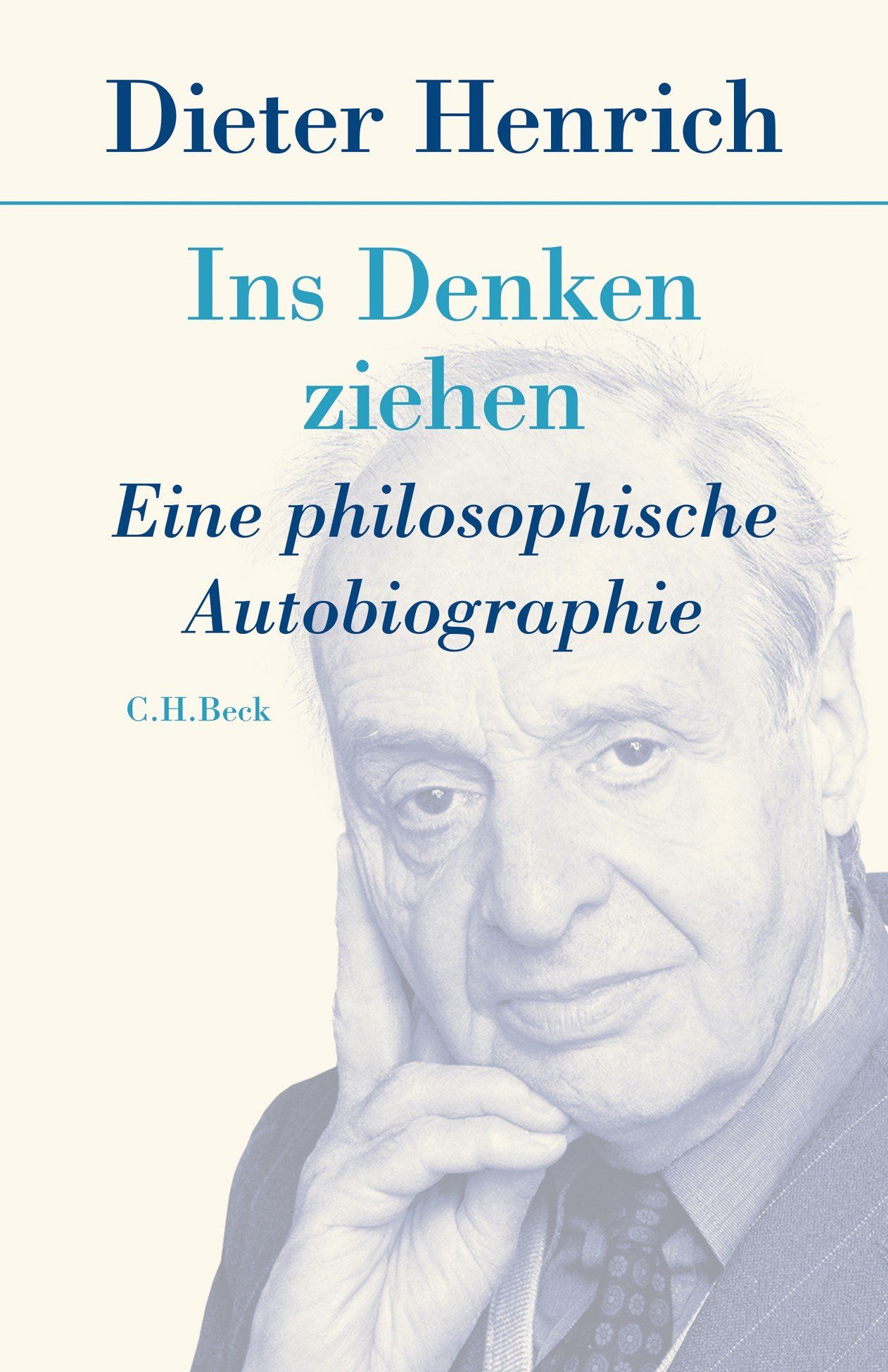von Michael Hesse
Zwei arrivierte Philosophen, auf dem Fußboden sitzend und eifrig auf ein Stück Papier ihre Einsichten kritzelnd: Vielleicht war es ja das, was der akademischen Philosophen-Szene der Nachkriegszeit gefehlt hatte. Eine gewisse Ungezwungenheit der eher biedermeierlichen Wirklichkeit. Die beiden Denker, die in eher Studenten-typischer Manier auf dem Hosenboden saßen, waren der Heidelberger Philosophie-Professor Dieter Henrich und der US-amerikanische Denker Roderick Chisholm. Sie hatten sich der Aufgabe gewidmet: "Wie lässt sich das, was Selbstbewusstsein ausmacht und impliziert, theoretisch entschlüsseln?" Die Geschichte der beiden Professoren erzählt ebenjener Dieter Henrich in seinem Buch "Ins Denken ziehen" (C.H. Beck), das eine Art Streifzug durch sein Leben und Wirken ist. Der autobiografische Versuch ist in Form eines Gesprächs angelegt. Henrich ließ sich hierfür von dem Olbenbourger Professor für Ideengeschichte, Matthias Bormuth, und Ulrich von Bülow vom Marburger Literaturarchiv befragen.
Der unterhaltsame Streifzug durch das Leben des früheren Professors in Heidelberg, Marburg, Berlin, Harvard und München wird unweigerlich ein Gang durch die verschiedenen Strömungen der Philosophie. Da Henrich eine zeitlang in den USA lehrte, schloss er Bekanntschaft mit einigen der wirkungsmächtigen Vertretern der analytischen Philosophie. Darunter war Chisholm und auch ein gewisser Hilary Putnam, der zu den brillantesten Denkern der USA gezählt werden kann. Putnams Ideen zur ewigen Philosophenfrage, ob sich die Existenz der Außenwelt beweisen ließe, fanden sich in aufsehenerregenden Gedankenexperimenten wieder, die als "Gehirne im Tank"-Überlegungen fast schon klassisch geworden sind. Der Spielfilm Matrix mit Keanu Reaves bedient sich genau dieser Thematik, da die menschlichen Körper, die von Maschinen als Batterien zur Energiegewinnung benutzt werden, genau diese Gehirne im Tank verkörpern. Ihnen wird eine Realität in Form einer Matrix vorgegaukelt. Henrich erzählt in seinem Buch, wie sehr Putnam durch seine Vorlesungen über Kant beeinflusst worden sei. Er habe sich gegenüber anderen in bei einem Deutschland-Auftenthalt mit einer gewissen Ironie und auch Übertreibung als "Student Henrichs" bezeichnet.
In Harvard hätten Henrich und Putnam ihre Besuch in der Vorlesung des anderen jeweils erwidert. So etwas habe er in Deutschland nie an einer Universität erlebt, erzählt Henrich. Er führt das auf die Angst unter Kollegen zurück, von dem anderen attackiert zu werden, womit eine gewisse Verschlossenheit einhergehe. Diese beruhte überdies lange Zeit darauf, sich gegen Einflüsse aus Übersee abzukanzeln.
Auch wenn heute einige Publizisten betonen, wie sehr die analytische Philosophie aus den USA den Kern eigentlichen Reflektierens verfehle, so stammen wohl viele der anregendsten Impulse der letzten Jahrzehnte eben von ihr. Henrich beschreibt, wie stark ihn einerseits die analytische Philosophie gefesselt habe, wie sehr er andererseits versucht habe, mit der Philosophie des deutschen Idealismus dagegenzuhalten: "Ich wollte unter anderem von Kant her 'kontinentalen' Einfluss auf die analytische Philosophie nehmen", erklärt er. Und hier plopte die genannte Frage nach dem Selbstbewusstsein auf, dem ego cogito, dem auch Kant nachspürte, aber anders als der französische Denker René Descartes keinen substanziellen Status mehr zuerkennen wollte, da die menschlichen Erkenntnismöglichkeiten eine derartige Einstufung nicht zuließen. Das Ich war ins Zentrum der deutschen Idealisten gerückt, die den Versuch unternahmen, mit einer Subjektphilosophie die Welt zu erklären.
Henrich hat in seinem akademischen Wirken einiges dazu beigetragen, die schwierigen Textpassagen zu klären und die Argumente von Kant, Fichte, Schelling oder Hegel ans Licht zu heben und zu klären. Studenten vieler Generationen haben seine Aufsätze wie "Fichtes ursprüngliche Einsicht" oder zu Kant "Die Deduktion des Sittengesetzes", Monographien wie "Identität und Objektivität" genauso gelesen wie die Hinführung zu Hegels Denken, die er in dem Büchlein "Hegel im Kontext" geleistet hat.
Am Interessantesten sind in dem Buch die Passagen, in denen sich die Philosophie-Geschichte in der Erinnerung eines einzelnen Subjekts widerspiegelt. Diese Erzählungen sind eine Art Hintertreppe ins Philosophen-Wohnzimmer, wenn Henrich davon berichtet, wie abhängig Hans-Georg Gadamer von seinem Lehrer Martin Heidegger gewesen sei, sprich, wie ängstlich er war, dessen Pfad zu verlassen - "er bewunderte Heidegger als Denker", erklärt Henrich. Er verweist aber auch auf eine gewisse Distanz zwischen beiden. Gadamer habe über Heidegger einmal gesagt, der habe zweierleich nicht: "Geschmack und politische Urteilskraft". Oder Henrich erinnert daran, dass das Erscheinen von Heideggers Aufsatzsammlung "Holzwege" im Jahr 1950 "ein Hammer" gewesen sei, da der wegen seiner Nähe zum Nationalsozialismus diskreditierte Meisterdenker, der ein Lehrverbot hatte, so lange nichts publiziert hatte. Zudem habe sich Heidegger bei einem Besuch bei Gadamer an der Heidelberger Universität gewundert, wie wenig die Studenten über seins, Heideggers Werk, wüssten, stattdessen würden sie wieder altes Zeugs lesen, womit unter anderem Hegel gemeint war. Auch Henrich fühlte sich angesprochen von den Worten des Meßkirchener Denkers, da Hegel ja einer seiner Leib- und Magenphilosophen war.
Henrich berichtet über die ersten Vorlesungen, die Karl Jaspers hielt, denen er als junger Mann beiwohnte und wo er dessen Intensität gespürt habe. Für Jaspers sei das Philosoph-Sein so etwas wie das In-der-Welt-sein gewesen. Hatte Gadamer dem jungen Henrich prophezeit: "Sie werden gewiss einmal Professor", so übertrumpfte dies Theodor W. Adorno noch einmal und sprach in einem Brief an Max Horkheimer: "... ein wahres Wunderkind, ein Zweiundzwanzigjähriger namens Henrich, der aussieht, wie man sich Shelley vorstellt, die Kritik der reinen Vernunft auswendig weiß und über unglaublich subtile Kantische Probleme diskutiert". Adornos Lob wollte er jedoch nicht erwidern, auch wenn er der erste gewesen sei, der Adorno in Frankfurt begrüßt habe, denn dessen Denken erschien dem jungen Studenten zu sophistisch, zwanzig Jahre später störte ihn die rattenfängernahe Rhetorik in Adornos Schrift "Negative Dialektik".
Und Henrich verweist aus eigener Erfahrung auf die pädagogische Grundwahrheit, dass für Studenten die Beziehung zu einem Lehrer immens wichtig ist, was den Fortgang betrifft. Im Gegensatz zu früheren Zeiten sei dies nun durch die Studienreform an den Universitäten massiv erschwert worden. Für ihn sei Gadamer einer dieser Wegbereiter gewesen, erzählt er. Die Begabteren unter den Studenten wählten diesen wohl auch deshalb, weil man bei ihm schwierige Themen intensiv durchdenken konnte. Für Henrich selbst wurde ein gewisser Fritz Baumgart zu einem Lehrer, der ihn in die Welt der Kunst einführte. Da war Henrich bereits an der FU in Berlin tätig, 1965 zog es ihn weiter, so dass er Rudi Dutschke nicht mehr als Lehrender an der Universität erlebt habe.
Henrich erzählt von einer weiteren Besonderheit in der westdeutschen Universitätslandschaft in den eher biedermeierlichen 50er Jahren. Denn in dieser Zeit bot er zumindest als Einziger in Heidelberg Marx an. Ein Problem scheint es indes nicht gewesen zu sein.
Das Buch ist lehrhaft, wirkt aber in seinem Duktus oft steif. Das ist verwunderlich angesichts der vielen Begegnungen, die der Philosoph im Laufe seines beruflichen Lebens machte, und auch angesichts seiner toleranten und offenen Haltung gegenüber zahlreichen Strömungen, von Marx bis zur analytischen Philosophie, die im Kreise westdeutscher Denker des Bürgertums zumeist Ablehnung erfuhren. Andererseits ist die Offenheit zum Teil überraschend. So das Bekenntnis, bei Alexander Mitscherlich eine Stunde nahm, um eine Psychoanalyse zu beginnen. Und als er auf seine Kindheitserfahrungen und den frühen Verlust der Eltern zu sprechen kommt. Oder wenn er davon erzählt, was für ihn als junger Philosoph wichtig war, nämlich erst einmal einen Stand in der Philosophie zu gewinnen, um sich von da aus in die großen Debatten zu stürzen. So ist das Buch auch für junge ambitionierte Studenten ist das Buch von Wert.
Henrich kannte Hegel, Kant und Fichte aus der Tiefe, und selbst Marx hat er von innen her beleuchtet. Er studierte in Frankfurt und Heidelberg, lehrte in Berlin, Heidelberg, Harvard und München. Der Denker, der ihn am stärksten anzog, war und blieb jedoch Kant. Am Ende des Buches bekennt er, dass seine Texte im Licht dieser Denker lebten. "Ins Denken ziehen" ist das Testament eines neugierigen Geistes, das ein kleines Abenteuer deutscher Geistesgeschichte darstellt.