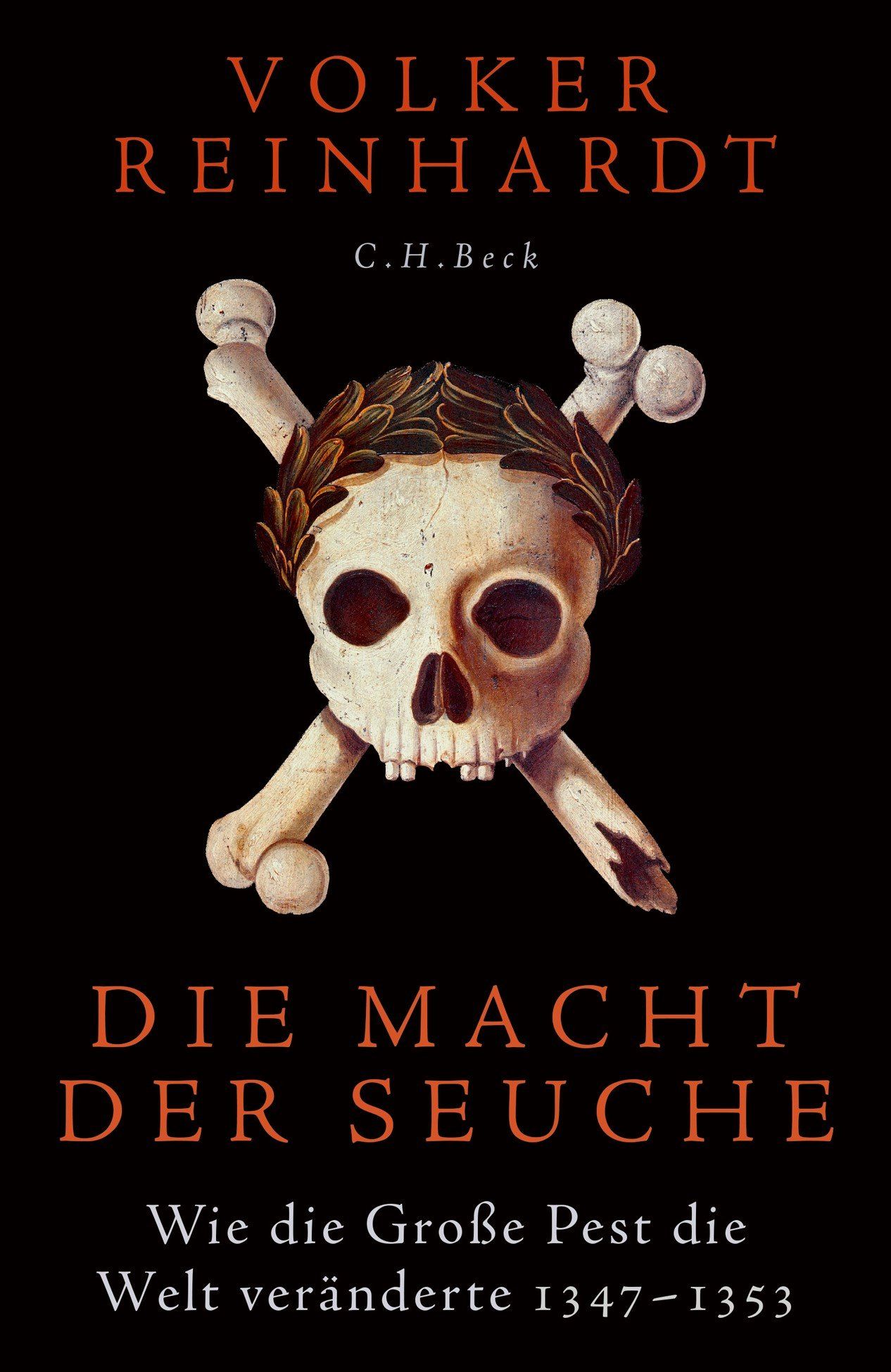Professor Reinhardt, wurde die Menschheit im Jahr 1348 ähnlich überraschend von der Pest überfallen wie die Welt heute von der Pandemie?
Ich würde sagen, sogar noch sehr viel mehr. Wir leben immerhin in einer Zeit der nach Schweinegrippe, Vogelgrippe und dem Sars-Ausbruch. Ein diffuses Gefühl der Bedrohung war immer da. In den Jahren 1347/48/49 rechnete niemand mit so einem Ausbruch. Eine Seuche dieses Ausmaßes lag zeitlich soweit zurück, dass auch das kollektive Gedächtnis es nicht mehr erfasste. Es hat im 6. Jahrhundert n.Chr., der sogenannten Spätantike, wohl eine ähnliche Pestepidemie gegeben, danach nichts wirklich Vergleichbares mehr. Insofern kam dieses plötzliche Massensterben völlig unerwartet. Die Schockwirkung muss einzigartig gewesen sein.
Wo bricht die Pest aus?
Die Schiffe kommen von der Krim Anfang Oktober in Messina an. Die Besatzung geht an Land und schon beginnt schlagartig das Sterben. Diese Schiffe fahren weiter, man verzichtet darauf, sie zu isolieren. Sie fahren die tyrrhenische Küste hoch und sind Anfang November in Marseille. Dann bricht die Pest in Frankreich aus.
Die Pandemie des 14. Jahrhunderts greift ähnlich schnell wie die im 21. Jahrhundert um sich?
Es gibt bereits effiziente Schifffahrtsrouten und es gibt Nachrichtenwege, die nicht so schnell sind wie heute, aber ein Eilkurier konnte die Distanz von Süditalien nach Norditalien in vier, fünf Tagen schaffen. Es ging auch in drei oder vier Tagen, wenn er seine Pferde zu Tode ritt. Das war eines der großen Rätsel: Es muss sich wie ein Lauffeuer verbreitet haben, was da in Sizilien geschah. Dazu war das zu neu und zu schrecklich. Dennoch wurden kaum Maßnahmen unternommen.
Wie ging es weiter?
Die Pest gelangte nach Mittelitalien und auch Norditalien. Nur an einer einzigen Stelle, in Mailand, hat man reagiert und Vorsorge getroffen, nämlich die Stadt mit Vorräten ausgestattet und komplett isoliert. Das Wunder von Mailand geschieht in einer Stadt von ungefähr 150.000 Einwohnern. Die Stadt bleibt pestfrei.
Warum ausgerechnet in Mailand?
Die Erklärung dafür ist eine soziale und ökonomische. In den übrigen Städten regieren Kaufmannsoligarchien, reiche Familien mit weit gespannten finanziellen Interessen, vor allem in Venedig, wo der Großhandel den sagenhaften Reichtum dieser Stadt hervorgebracht hat. Und diese Leute haben kein Interesse daran, die Handelsbeziehungen zu unterbrechen. Dass das ein schwerer Fehler war, merkt man erst zu spät.
Die Maßnahmen, die Mailand ergriff, ähneln auch den heutigen. Sie zeigen ja ein aktives Handeln auf und nicht Ergebenheit in das Schicksal.
Es gab einen eklatanten Unterschied. Die sogenannten Experten der damaligen Zeit, Mediziner, Astrologen, Theologen sagen, es sei eine Gottesstrafe, vergiftete Luft kommt durch eine ungünstige Konjunktion der Planeten auf die Erde, dahinter steht der strafende Gott. Wenn man die Erklärung so pauschal akzeptiert, konnte man ja gar nichts machen. Man konnte Gott walten lassen, auf Gott vertrauen, man konnte höchstens Gott um Verzeihung und Gnade bitten. Das Handeln in Mailand ist anders ausgerichtet, hier geht man davon aus, dass man etwas machen kann und widerlegt im Grunde auch die Theorie der vergifteten Luft. Denn die müsste ja eigentlich überall sein. Es gibt ähnliche Beispiele. Der damalige Papst reagiert auch richtig, er lässt einfach niemanden mehr zur Audienz zu, er isoliert sich und schützt sich auf diese Weise. Die jungen Damen und Herren von Boccaccios Dekamerone machen es ähnlich. Sie begeben sich aufs Land in ihre Villa, lassen sich von ausgewählten Personen bedienen und sehen sonst niemanden. Der gesunde Menschen verstand war weiter als die Theorie der Medizin.
Wie veränderte sich das gesellschaftliche Leben? Gab es Unruhen und Aufstände? Löste sich die öffentliche Ordnung auf?
Es ist auf jeden Fall ein schwerer Schlag für das soziale Gefüge gewesen. Vieles wird auf die Probe gestellt. Die öffentliche Ordnung bricht jedoch nicht zusammen, hier bin ich anderer Meinung als die ältere Forschung. Es wird weiter gewählt, die Ämter werden weiter besetzt. Auch Kunstaufträge laufen weiter. Der Mensch ist ein relativ robustes Lebewesen. Der in der Forschungsliteratur vielzitierte Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung hat nachweislich nicht stattgefunden.
Wie groß waren die Verluste?
Mittelwerte liegen zwischen 25 bis 30 Prozent der Menschen, die dem Erreger zum Opfer fielen. Auch in China, wo das Bakterium herstammte soll es Schätzungen zufolge viele Millionen Tote gegeben haben. In Europa gab es an manchen Orten gewiss eine Todesrate von bis zu 75 Prozent der Menschen. Ganze Klostergemeinschaften starben aus. Die Menschen lebten dort auf engen Raum zusammen, die Infektion hatte bessere Ausbreitungschancen. Getroffen wurden vor allem die Unterschichten, die Armen lebten eng zusammen.
Und auf dem Gebiet des heutigen Deutschland?
In Deutschland gab es relativ niedrige Sterberaten, 10 bis 15 Prozent schätzt man. Es gibt aber fraglos auch Städte, wo die Mehrheit der Bevölkerung ums Leben kommt.
Wie sieht der Unterschied zwischen Stadt und Land aus?
Die Stadt ist Hotspot. Es gibt aber Berichte, dass ganze Landstriche verödet sind, dass Bauernhöfe aufgegeben werden, Felder nicht mehr bearbeitet werden. Manche Gegenden waren regelrecht menschenleer. Potenziell ist die Todesrate in der Stadt höher, da die Wohnverhältnisse beengter sind.
Wir sehen heute, wie schnell vermeintliche Helden, zumeist Politiker, in der Gunst der Öffentlichkeit abstürzen. Welche Helden gab es damals?
Der Superheld in den Augen der Menschen ist der brutal agierende und rücksichtslos zugreifende Stattherr von Mailand. Das soll kein Lob des starken Mannes sein. Aber stellen Sie sich heute vor, dass eine Stadt oder ein Land coronafrei bleibt, wer dafür politisch verantwortlich ist, wird mit bis zu 90 Prozent wiedergewählt werden.
Wie stark wurde die Wirtschaft getroffen?
Das Wirtschaftsleben läuft weiter. Es gibt keine Berichte über Hungersnöte. Die hätten sofort eintreten müssen, da die Versorgungslage der Städte auch in normalen Jahren immer schwierig gewesen ist. Lebensmittel wurden jedoch teurer. Die Ökonomie hält letztlich stand. Das hängt auch damit zusammen, dass die Pest für kürzere Zeit wütet als Corona. Sie dauert in der Regel nicht länger als ein halbes Jahr. Der Aderlass ist dennoch groß.
Mit welchen Folgen?
Gerade weil die kleinen Leute überproportional wegsterben, haben es die Überlebenden aus dieser Schicht besser, die Arbeitskraft wird knapp, dadurch steigen die Löhne einige Jahre. Das ist ein Mechanismus, den wir bei allen Epidemien bis zum 18. Jahrhundert beobachten können. Diejenigen, die nun Pachten übernehmen, können dies zu besseren Konditionen tun. Das ärgert die Grundbesitzer natürlich. Die Überlebenden profitieren also zweifach: Sie leben und kommen in den Genuss besserer Kaufkraftbedingungen.
Die Ungleichheit wird durch die Pest reduziert?
Ein bisschen jedenfalls. Der Effekt hält nicht allzu lange an. Er wiederholt sich jedoch, da die Pestepidemien wiederkommen. Es gibt noch einen weiteren Effekt.
Welchen?
Eine große Zahl alteingesessener Familien stirbt aus, neue rücken nach, entfernte Verwandte, manchmal ganz neue Familien. Für sie sieht es am Anfang sehr gut aus, aber nicht sehr lange. Diese Aufsteiger aus dem sozialen Nichts sind unbeliebt. Sie werden von der alten Elite relativ schnell zurückgedrängt. Diese Parvenüs haben nicht lange Konjunktur.
War die Pandemie eine Zeitenwende?
Nein. Die elementare Reaktion, die auch einige Jahre anhält, ist Rückwärtswendung, Nostalgie, Sehnsucht nach der verlorenen Normalität, Orientierung an scheinbar verbürgten alten Werten. Das ist eine normale Reaktion. Man wird konservativer. Das ist so wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat ein Menschheitsgemetzel angezettelt und in den 1950er Jahren dreht man einen Heimatfilm nach dem anderen. Man will sich an einer vermeintlich besseren Vergangenheit orientieren.
Also kein Aufbruch von der Pestzeit in die Renaissance?
Einen direkten Link zwischen Pest und Renaissance gibt es nicht. Der Begriff der Renaissance ist ohnehin sehr problematisch geworden. Sie lässt sich dadurch definieren, dass sich die Kluft zwischen den oberen und unteren Schichten vergrößert, dass sich neue Medien entfalten, ein neuer Kunststil aufkommt. Das geschieht ja auch erst ein Menschenalter nach der Pest. Man kann darin am Ende eine gewisse Trotzreaktion sehen. Nachdem die Pest fünf, sechsmal zurückgekommen ist, das Elend sich weiter gesteigert hat, verkünden Literaten und Künstler ein positiveres Menschenbild, nach dem Elend jetzt die Würde des Menschen.
Ein weiterer Trend war in der Pest die Stadtflucht. Die Verstädterung nahm dennoch zu?
Wirklich neue Trends gibt es nicht. Die Geschichte nimmt mit einigen nicht unwesentlichen Veränderungen ihren Lauf. Den Humanismus als Kulturströmung gibt es vorher, die Verstädterung gibt es vorher, die wirtschaftliche Entwicklung geht weiter, wenn auch auf reduziertem Niveau. Die Geschichte wird weder aufgehalten, noch bekommt sie neue Züge. Es gibt Veränderungen, allein schon die Anzahl der Menschen nimmt ab. Das Modell, das sich in Mailand bewährt hat, setzt sich immer stärker durch. Auch in Florenz. Die Medici sind verschleierte Einzelherrscher. Sie regieren bis ins zweite Viertel des 16. Jahrhunderts hinter einer republikanischen Fassade. Die Trends zur Einzelherrschaft verstärken sich. Die führenden Schichten grenzen sich weiter von den Mittelschichten ab. Europa wird aristokratischer. Das ist nicht nur in Italien so. Ich bringe es auf die Formel: Die Pest verändert einiges, sie verstärkt Entwicklungen, aber sie bewirkt keine wirkliche Umkehr und keine entscheidenden Innovationen.
Nimmt die Härte der Verteilungskämpfe zu?
Ich habe gelesen, dass die Superreichen in der Corona-Pandemie noch reicher geworden sind. Das bestätigt sich auch nach der Pest. Der Einfluss der Führungsschichten verstärkt sich. Hoffnungen auf ein neues soziales Klima gibt es schon damals. Aber es tritt der gegenteilige Effekt ein. Man ist der Meinung, dass die Menschen eher noch böser geworden sind. Vorhersagen sind immer problematisch. Wenn sich Corona durch Impfen und wärmere Temperaturen 2021 erledigt haben sollte, wird das eine Episode bleiben. Es wird keine Wendezeit sein. Auch die Hoffnung auf einen besseren Menschen sollte man fahren lassen. Um Machiavelli zu zitieren: Dankbarkeit gehört nicht zum menschlichen Wesen, sondern eher das Gegenteil.
Wäre eine Lehre aus der Zeit, gelassener in die Zukunft zu blicken?
Das wäre eine konkrete Lehre, die man aus dieser Zeit sicher ziehen kann. Gerade während der Seuche gab es zahlreiche Phobien, die Welt gehe zu Ende, Gott leite das Jüngste Gericht ein, man müsse sich auf das Weltenende vorbereiten. Die politisch Verantwortlichen können nicht tatenlos bleiben, weil sie sonst ihre Legitimität einbüßen. Sie müssen hektische Aktivitäten entfalten, die zum großen Teil sinnlos, manchmal kontraproduktiv sind. Etwa wenn man Bittprozessionen organisiert. Eigenständig Rückschlüsse ziehen, die Expertenmeinung ernstnehmen, breiter vergleichen, die Virologen und Epidemiologen sind ja keinesfalls in allen Punkten einig gewesen. Gerade in Zeiten der Krise ist Rationalität angesagt. Wie etwa bei Papst Clemens VI., der die Juden von dem perfiden Vorwurf freispricht, die Pest verbreitet zu haben und das glasklar auch beweisen kann. Das meint Gelassenheit. Die Dinge so rational wie möglich zu betrachten.
Interview: Michael Hesse