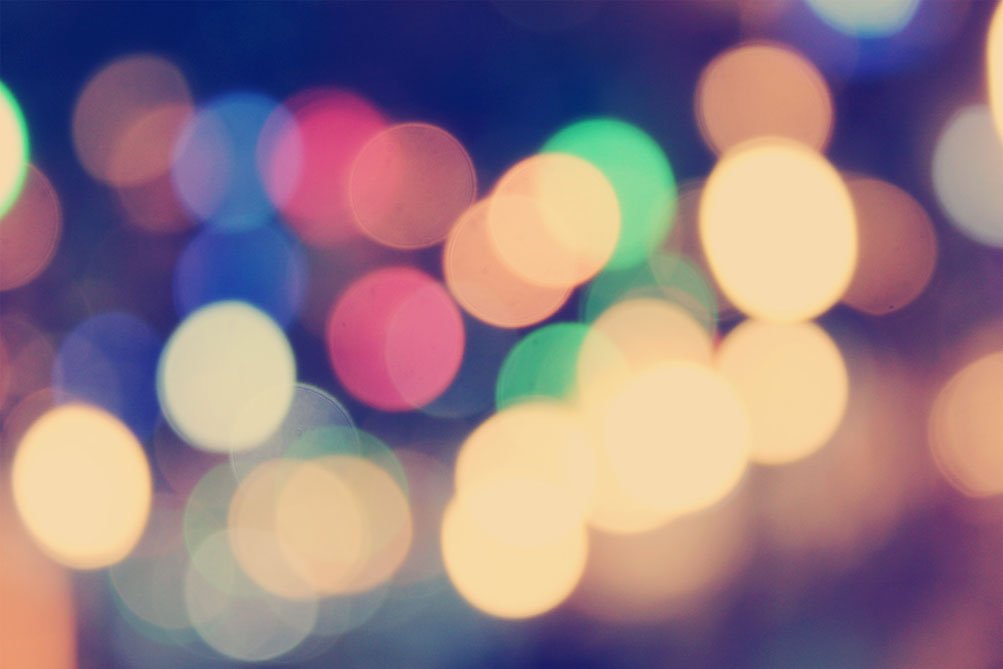Professor Snyder, was hatten Sie für eine Krankheit? Wie geht es Ihnen?
Es geht mir besser, ganz gut. Ich hatte eine Blinddarmentzündung und in der Folge eine Leberentzündung. Das führte zu einer unerkannten Sepsis, also eine Blutvergiftung. Die Ärzte haben viele Fehler gemacht, die mich fast umgebracht haben. Mir geht es aber nicht um mich, sondern um die Frage, warum man im amerikanischen System an einer Blinddarm-Entzündung sterben kann. Es sollte an sich nicht möglich sein, ist aber leider ganz normal.
Was lässt sich über dieses System sagen? Was ist das zentrale Problem?
Es ist ein bisschen schwierig, das zu erklären. Es ist fast so, als würde man eine andere Sprache sprechen. Wenn man das Wort Gesundheitssystem ausspricht, hat man ein Bild im Kopf. In den USA gibt es kein System in diesem Sinne. Gesundheit ist für die Amerikaner so etwas wie Autos oder ins Kino zu gehen. Wenn man im Krankenhaus liegt, muss man sich ständig fragen, ob die Ärzte oder Krankenschwestern aus finanziellen Gründen so handeln oder ob es ihnen jetzt um die Gesundheit geht. Die Amerikaner haben das Problem, dass man den eigenen Körper nicht als ein Subjekt des Rechtes begreift, man denkt, dass es normal ist, wenn der Körper ein Profit-Objekt für andere ist. Wir haben ein falsches Verständnis von Freiheit, es ist beschränkt und negativ. Wir sehen nicht, dass unser Leiden unser früher Tod im Vergleich zu anderen Ländern, alles das ist eigentlich ein Problem der Freiheit.
Es ist ein medizinisch-industrieller Komplex, der dafür verantwortlich ist?
Das Problem ist ein systemisches Problem. Das ganze amerikanische System ist gewinnorientiert. Ich habe viele Erfahrungen mit Ärzten in Europa und den USA gemacht. Die Mediziner in Österreich konnten sich mehr Zeit für die Patienten nehmen als in den USA. Das heißt aber nicht, dass sie bessere Ärzte sind. Sie arbeiten lediglich in einem besseren System. Die amerikanischen Ärzte müssen in einem sehr schlimmen System arbeiten. Sie haben meine Sympathie. In Amerika ist es so, dass der Patient denkt, der Arzt wäre in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Aber das ist leider selten der Fall. Der Arzt ist eher ein Opfer des Systems. Wenn man das System ändern könnte, die Ärzte mehr Freiheit hätten, wären wir alle freier und gesünder.
Welche Folgen hat das in der Pandemie?
Die Hälfte der Amerikaner hatte das Gefühl, dass sie es sich nicht leisten konnten, ins Krankenhaus zu gehen. Zudem gab es kaum die Möglichkeit, einen nationalen Notfallplan umzusetzen. Die Lehre ist, dass in Krisenzeiten ein rein kommerzielles System nicht funktioniert.
Was hat sich in der Gesellschaft und der Politik verändert? Sie kritisieren eine neue oligarchische Struktur in den USA.
Damit man das versteht, muss nur an Donald Trump und seine Infektion mit dem Coronavirus denken. Was machte Trump anschließend? Er sagt, er sei Superman. Das ist das Problem. Es gibt eine Schicht, eine sehr kleine, aber sehr mächtige und reiche Elite, die der Auffassung ist, dass sie kein Teil der Zivilgesellschaft ist. Von Platon bis Raymond Aaron weiß man: Wenn es mächtige reiche Leute gibt, die über so eine Macht verfügen, dass sie denken, sie würden nicht zu dem Land gehören, dann gibt es ein Problem. Ihnen kommt es gar nicht erst in den Sinn, dass es eine Notwendigkeit für ein Gesundheitssystem gibt. Wenn man soviel Geld wie sie hat, hat man in den USA Zugang zu guten Ärzten. Das zweite Problem ist der Rassismus. Jedesmal, wenn man den Versuch unternimmt, ein Gesundheitssystem zu errichten, kommt die Antwort von irgendeinem rechten Politiker: Wir können das nicht haben, weil es nur von Immigranten und Schwarzen ausgenutzt wird. Zu den weißen Amerikanern sagen sie dann: Ihr seid stark, ihr seid hart, ihr braucht so ein System gar nicht. Wegen dieser rassistischen Denkweise haben Reformer ein Problem.
Die Eliten haben mehr Ähnlichkeit zu Eliten anderer Länder, die größer ist als zu den amerikanischen Bürgern?
Die Griechen haben das Wort Oligarchie in ihrer Sprache gehabt, Aristoteles hat es in die Philosophie eingeführt. Seit den 90er Jahren wurde das Wort im Russischen verwendet, um die Situation in Russland, der Ukraine und leider immer mehr auch in den USA zu beschreiben. Eine gewisse Elite denkt, sie sei in der Lage, außerhalb der normalen Regeln zu leben. Platon sprach von einem Staat der Reichen und einem Staat der Armen. Die gibt es leider. Das hat Auswirkungen auf jedem politischen Feld, besonders stark ist es jedoch beim Thema Gesundheit. Hier muss man einfach zusammenarbeiten. Leider ist es schwer, hierüber in den USA eine Debatte zu führen.
Führt das zu einer Gefährdung in den USA?
Die amerikanische Denkweise sagt, Freiheit ist Freiheit von etwas. Sie wird als ein negativer Begriff aufgefasst, in dem sie von etwas befreit, was irgendwie im Weg ist. Aber gerade wegen der Abwesenheit eines Gesundheitssystems und eines Wohlfahrtstaates gibt es zuviel Angst im System. Die Menschen werden aber wegen ihrer Angst zu einem Spielball im politischen System. Das treibt uns weg von der Demokratie und hin zur Autokratie. Gerade Trumps Politik besteht darin, die Menschen in dieser Hinsicht zu manipulieren. Er weiß, dass es für ihn besser ist, wenn die Menschen Angst haben. Ich bin sicher, dass die Demokratie besser funktionieren würde, wenn die Menschen die Angst nicht hätten.
Auch die Pandemie sehen Sie als Bedrohung der Demokratie an?
Das gilt nicht nur für die USA, sondern für jedes Land. In den USA gibt es einen Präsidenten, der seine eigene Krankheit benutzt, um zu sagen, dass er ein starker Mann ist. Die Pandemie wurde benutzt, um Emotionen zu wecken. Die Pandemie ist ein systemisches Problem. Sogar unsere Wahl ist in Gefahr. Ich glaube allerdings nicht, dass er an der Macht bleibt und die Wahl gewinnt. Aber er schürt diese Emotionen, weil er glaubt, dass es ihn an der Macht halten würde.
Wird er das Weiße Haus verlassen bei einer Niederlage?
Die primäre Frage ist, was man nach Trump in Angriff nimmt. Trump ist kein Demokrat. Er mag Demokratien nicht. Er hat immer gesagt, er akzeptiere nur eine Wahl, wenn er gewinnt. Wir wissen von vorneherein, dass er seine Niederlage nicht akzeptieren wird. Bei allem, was er sagt, geht es ihm nur darum, Chaos zu stiften. Er hofft, dass er aus dem Chaos als Präsident hervorgeht. Biden geht davon aus, dass seine Mission darin besteht, die Wahl zu gewinnen.
Ist Biden der richtige Mann für eine Veränderung.
Ist Biden der richtige Mann für eine Veränderung. Er ist nicht radikal, aber es gibt Hoffnung. Biden kann anderen zuhören, die etwas Wichtiges zu sagen haben. Darauf wird er sich einlassen. Man kann jetzt nicht zurück gehen. Es gibt kein Zurück ins Jahr 2016. Man hat gesehen, dass Trump nicht das einzige Problem ist. Die Probleme muss man angehen. Biden wird gute Leute haben, die gute Entscheidungen treffen können.
USA sind sehr gespalten. Was kommt nach der Wahl? Ein Bürgerkrieg?
Ein Bürgerkrieg? Im November und Dezember, vielleicht. Trump bettelt durch seine Aussagen ja förmlich um Gewalt. Aber man sucht in der amerikanischen Geschichte ja krampfhaft nach einem Moment, in dem die Menschen nicht gespalten wurden. Ich bin optimistisch, wenn man bestimmte Bedingungen schafft. Wenn man ein weniger gespaltenes Amerika haben will, muss man an die Grundlagen gehen, und dazu zählt das Gesundheitssystem. Es wird nicht gehen, dass man nicht polarisieren wird. Aber es gibt doch klare Mehrheiten für eine Reform des Gesundheitssystems. Die öffentliche Meinung in den USA unterscheidet sich da nicht so sehr von der in Deutschland. Wir haben die Chance, das System zu ändern. Dann nimmt auch die Polarisierung ab.
Wenn sie Europa mit den USA vergleichen, sollten die Europäer zufriedener sein mit dem, was sie haben?
Ich habe das Buch für die Amerikaner geschrieben. Ich wollte den Amerikanern zeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Das amerikanische Problem ist, dass sie alles zuerst machen wollen und nichts von außen übernehmen möchten. Als Deutscher, Österreicher, Schweizer oder Europäer kann man das Buch als Warnung nehmen. Es ist sehr leicht, ein gutes System zu vernichten. Wenn man Effizienz als einen Wert an sich betrachtet, hat man das amerikanische System. Effizienz ist jedoch gar kein Wert. Gesundheit, Freiheit, das sind Werte! Wenn man über Effizienz redet, dann redet über Geld. Und das ist unser Problem in den USA. Das Gesundheitssystem steht dem Geld näher als der Gesundheit. Den Europäern wünsche ich das nicht.
Viele demonstrieren in Deutschland und anderen Ländern, die glauben, dass die Pandemie eine Erfindung ist.
Ich will gar nicht sagen, dass die Amerikaner immer unrecht haben, die Europa aber immer richtig liegen. Die Argumentation in Deutschland ist identisch mit der in den USA. Man sagt die gleichen Dinge. Das Problem ist das Internet, die Verschwörungstheorien sind immer die gleichen, ob in Kansas oder in Bayern. Das Grundproblem ist, wie man den Glauben an Fakten erweitert. Das Problem in Deutschland ist genauso wie in den USA. Es gibt allerdings weniger Menschen in Deutschland, die das glauben, als in den USA. Man muss die Fakten der Wissenschaften als Werte betrachten, um eine Demokratie zu haben. Wenn man das nicht tut, wird Freiheit auf Emotionen reduziert. Ich habe das Gefühl, in einer Diktatur zu leben. Ich habe das und das gehört. Freiheit gibt es nicht, wenn man nur nach eigenen Emotionen handelt. Dann ist man das Opfer der eigenen Illusionen. Man braucht Fakten und Diskussionen, um frei zu sein.
Interview: Michael Hesse
Zur Person:
Timothy Snyder lehrt Geschichte an der Princeton-University. Sein neues Buch trägt den Titel: Der Weg in die Unfreiheit. Russland, Europa, Amerika. Aus dem Englischen von Ulla Höber und Werner Roller. C. H. Beck Verlag, München 2018. 376 Seiten, 24,95 Euro.